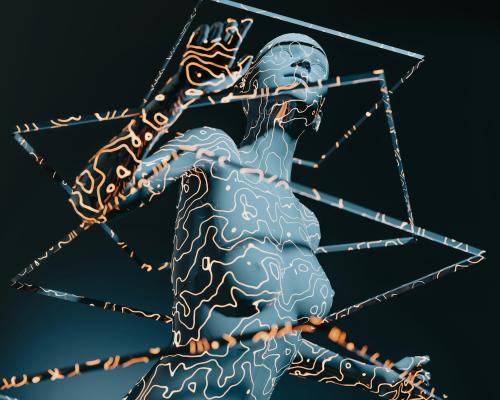Für alle, die lieber lesen als hören:
Unsere heutige Interviewpartnerin ist Kerstin Schachinger. Sie ist Trainerin, Coach, Gründerin von waldzeit Coaching und begleitet Menschen dabei, ihre Stärken und Kompetenzen zu reflektieren und ihren Lebensweg sinnorientiert zu gestalten.
Mit Kerstin möchte ich heute über ein Thema sprechen, mit welchem wirklich jede und jeder mehr oder weniger häufig einmal konfrontiert wird, über das aber – besonders in der Arbeitswelt – viel zu wenig gesprochen wird: Nämlich das Gefühl der Unsicherheit im Job. Sich unsicher zu fühlen, kann in verschiedensten beruflichen und natürlich auch privaten Kontexten auftreten. Und das ist erst einmal natürlich völlig normal und menschlich, kann aber, je nachdem, wie oft und wie stark dieses Gefühl auftritt, sehr belastend und hemmend sein. Erschwerend kommt hinzu, dass Unsicherheit im Job schon fast ein Tabuthema ist und viele daher versuchen, mit diesem Gefühl irgendwie selbst klarzukommen, obwohl ein Austausch mit anderen Menschen viel hilfreicher wäre. Und genau aus dieser Tabuzone möchten Kerstin und ich die Unsicherheit heute einmal herausholen und offen darüber sprechen, was eigentlich hinter diesem Gefühl steckt und wie man einen konstruktiven Umgang damit finden kann. Deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen, Kerstin, und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast!
Kerstin Schachinger: Ja, hallo. Danke sehr, dass ich hier sein darf.
Charlotte Clarke: Ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt in das Thema ein und fangen vielleicht ganz am Anfang an, nämlich damit, den Begriff der Unsicherheit einmal etwas näher und differenzierter zu betrachten. Denn mit dem Begriff Unsicherheit verbinden viele Menschen ja eher negative Gefühle, zum Beispiel Ängstlichkeit und Scheu. Oder man schämt sich irgendwie dafür, dass man nicht souverän auf andere wirken könnte, sondern eher unsicher. Gibt es denn auf dieses Gefühl vielleicht auch eine andere Perspektive? Welche positiven Botschaften oder welches Potential kann sich im Gefühl von Unsicherheit verstecken?
Du suchst nach einem Job mit Sinn?
Du suchst nach einem Job mit Sinn?
Kerstin: Ja, erst einmal finde ich die Frage total schön, weil viele sich genau diese nämlich gar nicht stellen, sondern davon ausgehen, dass Unsicherheit automatisch etwas Negatives ist, weil sie oft sprachlich so konnotiert ist und in unserer Gesellschaft auch so gelebt wird.
Sobald wir uns unsicher zeigen, ist damit verbunden, dass wir oft so ein bisschen »das Gesicht verlieren«, was es ja auch in anderen Kulturen noch viel stärker gibt als bei uns. Und trotzdem haben viele von uns das so verinnerlicht, auf keinen Fall, in keiner Sekunde Unsicherheit zeigen, weil ansonsten werden wir vielleicht ertappt dabei, dass wir gar nicht so gut sind, wie wir denken.
Zu meinem Zugang gehört, sich die Begriffe immer genau anzuschauen und positive Alternativen zu finden. Und Unsicherheit bedeutet ja erst einmal, anzunehmen und sich selbst einzugestehen, dass man noch nicht alles weiß und noch nicht alles kann. Und alles andere wäre ja auch so ein bisschen unmenschlich. Und von daher ist es das Natürlichste auf der Welt zu sagen: Ich kann nicht alles, ich weiß nicht alles, und das ist gut so. Ich bin nicht das Lexikon. Und selbst im Lexikon steht nicht alles drin. Und dann kommt da gleich so ein bisschen Entspannung rein und dann geht auch vielleicht diese Ängstlichkeit und diese unsichere Anspannung, die da manchmal damit verbunden ist, gleich ein bisschen weg. Und dann können wir aufeinander eingehen und wirklich auf Augenhöhe miteinander sprechen.

Charlotte: Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass man da den Mut fasst, einfach einmal mit anderen Menschen darüber zu sprechen und offen damit zu sein. Das ist ja gerade in der Arbeitswelt oftmals mit Hemmungen verbunden und genau dort kann die Unsicherheit gleich auf mehreren Ebenen auftreten.
Und vielleicht beginnen wir da ganz am Anfang, nämlich mit der Jobsuche. Hier könnte sich Unsicherheit zum Beispiel darin äußern, dass ich eine total tolle Stellenausschreibung finde, sozusagen die perfekt passende Stelle bei meinem nachhaltigen Traum-Arbeitgeber. Und anstatt mich sofort an eine Bewerbung zu setzen und die selbstbewusst abzuschicken, kommen da diese zweifelnden Stimmen in meinem Kopf. Und dann kommen so Fragen auf wie: »Bin ich überhaupt gut genug für diesen Job und sollte ich mich da überhaupt bewerben? Habe ich da überhaupt eine Chance?« Wie kann ich solchen Zweifeln konstruktiv begegnen?
Kerstin: Das kenne ich von mir selbst wahnsinnig gut. Und ich habe schon mit so vielen Menschen gesprochen, denen es ähnlich geht. Mir sind da zwei Sachen total wichtig. Das eine ist, dass ich vor kurzem einen spannenden Artikel gelesen habe genau zu dem Thema: Oft bewerben sich Führungskräfte nur dann, wenn sie 100 Prozent der Stellenausschreibung erfüllen. Und ich finde, das ist genau der Punkt: Wir lesen Stellenausschreibungen wie eine Checkliste und setzen innerlich einen Haken an die Aspekte, wo wir denken, die können wir zu 100 Prozent erfüllen. Und da, wo wir schon nur noch bei 50 Prozent sind oder vielleicht bei 80 Prozent, setzen wir schon gar kein Häkchen mehr daran. Und wenn wir nicht überall ein Häkchen daran setzen, dann bewerben wir uns nicht. Und genau da liegt dann auch der Fehler im System. Denn aus Unternehmensperspektive – und ich finde diesen Perspektivwechsel auch immer eine ganz schöne Herangehensweise – braucht die Organisation oder das Unternehmen ja Menschen, auf die sie sich verlassen kann und die bereit sind, sich in Themen auch einzuarbeiten, wo auch Entwicklungspotential da ist.
Wenn ich mich als Bewerber*in für einen Job bewerbe, wo ich schon alle Kriterien erfülle, schon alles kann, was dort steht, dann bin ich vielleicht nach einem halben Jahr wieder weg, weil mir langweilig wird in dieser Position. Dann will ich von der Organisation oder vom Unternehmen sofort Entwicklungsperspektiven, will gleich den nächsten Job angeboten bekommen, will die Möglichkeit haben, aufzusteigen. Vielleicht geht das allerdings in kleinen Unternehmen oftmals auch gar nicht.
Das heißt, es ist erst einmal wichtig, immer zu reflektieren: Geht es hier um meinen hohen Anspruch, den ich an mich selbst habe? Und wie kann ich den vielleicht überkommen? Wie kann ich sagen: »Gut, also 50 Prozent erfülle ich, ich probiere das jetzt einfach mal.« Und dann komme ich ja ins Gespräch. Und erst im Gespräch kann man dann herausfinden, was wirklich die wichtigen Faktoren sind. Was ist essentiell und was ist nice to have? Dann bekommt man gleich ein besseres Gefühl dafür, als wenn man vor so einer Liste sitzt.
Unterstützen kann, immer wieder zu reflektieren, wo kommen denn dieser Perfektionismus und dieser hohe Anspruch her? Warum möchte ich denn eigentlich Menschen beeindrucken? Oder warum möchte ich diese 100 Prozent eigentlich erfüllen? Ist es nicht auch okay zu sagen: »Ja, ich kann nicht alles, und das ist auch gut so. Ich bin bereit, dazuzulernen und ich kommuniziere, liebe Personalabteilung, ich bin total motiviert, mich in diesen Bereichen weiterzuentwickeln.« Wenn ich dann auf der anderen Seite sitze und das lese, denke ich mir, das ist doch super. Da ist jemand, der hat Lust, zu lernen und sich weiterzuentwickeln!
Charlotte: Eine total spannende Perspektive. In einem Bewerbungscoaching, das ich einmal gemacht habe, sagte die Coachin, dass wenn man 60 Prozent der Anforderungen in Stellenausschreibungen erfüllt, dann ist man schon verdammt gut bzw. überdurchschnittlich gut – also nur 60 Prozent! Dass aber diese fehlenden Prozent nicht nur sozusagen geduldet werden, sondern sogar willkommen sind und als Entwicklungspotential und auch so ein bisschen als Sicherheit gesehen werden, dass man nicht sofort wieder geht, weil einem langweilig ist – das war mir jetzt aber auch neu.
Dann gehen wir einmal davon aus, dass diese Zweifel in den meisten Fällen unbegründet sind. Die Bewerbung hat geklappt. Ich habe den Traumjob bekommen und jetzt sitze ich an meinem ersten Arbeitstag im neuen Job an meinem neuen Schreibtisch und denke mir: »Oh mein Gott. Was wird jetzt von mir erwartet und wie finde ich in meine Rolle?« Kannst du vielleicht ein paar Strategien verraten, die einem dabei helfen können, mit einem guten Gefühl die ersten paar Wochen und Monate im neuen Job zu überstehen?
Kerstin: Am Anfang geht es ja darum, sich erst einmal gegenseitig kennenzulernen. Und man sollte so ein Gefühl dafür bekommen, wer hier welche Rolle, wer welche Verantwortung hat. Und langfristig gesehen: Worauf können wir uns bei den anderen verlassen, welche Aufgaben kann ich dieser Person geben? Und in der ersten Phase: zuhören, zuhören, zuhören und noch einmal zuhören. Also wirklich die Ohren spitzen und wirklich beobachten: Was wird hier für eine Sprache gesprochen? Was sind hier wichtige Themen? Welche Bedürfnisse sind da? Wo sind Kolleginnen und Kollegen überarbeitet? In welchen Bereichen brauchen die anderen Hilfe, Unterstützung? Wie ist hier das Team aufgestellt? Arbeiten die anderen als Team wirklich aktiv zusammen und kann ich schnell sagen: »Hier, gib mir doch mal diesen Stoß an Papieren. Ich kann dir helfen, das abzuarbeiten. Das ist überhaupt kein Problem, du kannst dich da auf mich verlassen.«
Das kann ich jedoch erst dann sagen, wenn ich vorher beobachtet habe, was die Bedürfnisse sind. Das heißt, die erste Phase wie gesagt zuhören, zuhören, zuhören, beobachten und dann auch wirklich sich nicht klein zu halten und sich nicht zu lange zurückzuhalten mit diesem Gefühl, ich bin ja neu hier. Wer bin ich denn, dass ich jetzt hier etwas sage? Das ist auch etwas, was viele machen und was ich immer wieder beobachte, was im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass einfach ein falscher Eindruck entsteht, nämlich der, dass diese Person schüchtern ist oder sich gar nicht einbringen möchte, obwohl das gar nicht die Intention war.
Und auch hier wieder der Perspektivenwechsel: Wenn ich als Arbeitgeber jemanden einstelle, dann mache ich das ja, weil ich möchte, dass mir Arbeit abgenommen wird oder dass eine bestimmte Aufgabe erfüllt wird. Und hier darf man dann auch, sobald man verstanden hat, wie der Hase läuft, proaktiv Vorschläge machen und findet dann automatisch seine Rolle. Dann fällt alles an seinen Platz, würde ich jetzt mal sagen. Und das erfordert natürlich ein Bewusstsein dafür, wo die eigenen Stärken und Kompetenzen liegen. »Was bringe ich von außen an Erfahrungen mit aus meinen bisherigen Lebensstationen, die hier hilfreich sind und die ich ja einbringen kann?« Und das kann man dann auch mit Selbstbewusstsein sagen und kommunizieren und aus der Haltung heraus fragen: »Was kann ich hier für einen Mehrwert stiften, wie kann ich euch unterstützen?«

Charlotte: Man könnte ja im Idealfall meinen, dass, wenn man diese Einarbeitungsphase irgendwann mal überstanden und seine Rolle gefunden hat, vielleicht schon ein paar erste Erfolge verzeichnen kann, das Gefühl der Unsicherheit mit der Erfahrung einfach verschwindet. Das ist ja in den meisten Fällen schlicht nicht so. Was kann ich denn machen, wenn dieses Gefühl der Unsicherheit sich trotz aller Erfolge und Erfahrungen trotzdem nicht auflösen möchte? Wenn ich zum Beispiel bei bestimmten unliebsamen Aufgaben immer wieder unsicher werde oder mir die prinzipielle Frage immer wieder stelle: »Arbeite ich überhaupt genug und reicht meine Performance?« Also dieser ständige innere Zweifler, der einfach nicht schweigen möchte – Wie kann ich damit umgehen?
Kerstin: Innere Zweifler können ja unterschiedlichste Ursachen haben. Und in meinen Augen ist es hier entscheidend, nicht an der Oberfläche zu bleiben und auch langfristig für sich Strategien zu entwickeln, immer wieder damit umzugehen und sich dann schrittweise weniger unsicher zu fühlen.
Eine Ursache kann sein, dass wir mit dem Glaubenssatz durch die Welt gehen, wir müssten es anderen recht machen. Wir müssten 100 Prozent der Anforderungen zu 100 Prozent der Zeit erfüllen. Und wenn wir einmal einen Fehler machen, passiert etwas Schlimmes. Also ich kann vielleicht ganz kurz von mir erzählen. Ich hatte in der Schule wahnsinnig gute Noten bis zu dem Zeitpunkt, wo das nicht mehr so war. Und zwar hatte ich am Gymnasium dann in der sechsten oder siebten Klasse zum ersten Mal eine Drei. Und für mich ist damals die Welt zusammengebrochen. Für mich ist wirklich die Welt zusammengebrochen, weil ich vorher nur die besten Noten geschrieben hatte. Und das war in Englisch. Das war meine erste Fremdsprache, es war für mich einfach ein Rätsel. Ich wusste nicht, wie ich das lernen sollte. Ich habe gedacht: »Okay, Grammatik, das kann ich ja irgendwie auswendig lernen.« Aber auf der anderen Seite geht es da ja ganz viel um Sprachgefühl, um Aussprache, um Ausdruck. Das war für mich alles komplett konfus und ich hatte keine Strategie, wie ich dem Herr werden sollte. Und mit 15 hatte ich die wahnsinnig tolle Gelegenheit, eine Sprachreise nach England machen zu dürfen. Dort bin ich so richtig ins kalte Wasser geworfen worden, konnte mich an Tag eins überhaupt nicht verständigen und habe das dann dort einfach gelernt. Also man lernt dann ja doch relativ schnell, sich irgendwie durchzuschlagen, wenn niemand Deutsch spricht. Und schlussendlich wollte ich dann tatsächlich, als ich mit der Schule fertig war, nichts lieber als Englisch studieren – was ich auch tat. Und bis heute liebe ich Englisch, fühle mich wahnsinnig wohl in dieser Sprache und in den Kulturen, wo Englisch gesprochen wird. Warum erzähle ich das?
Diese inneren Zweifler sind häufig die erste Reaktion, wenn wir uns irgendwo unsicher fühlen oder wenn wir uns fragen: »Bin ich hier gut genug? Mache ich diese Arbeit wirklich gut?« Die allererste Reaktion, genau wie ich damals, als ich eine drei bekommen hatte und erst einmal die Welt zusammengebrochen ist. Und es ist so wichtig, einen Schritt zurückzutreten, sich das Ganze aus einer Vogelperspektive heraus anzuschauen und erst einmal durchzuatmen und zu schauen: »Was passiert hier gerade eigentlich? Mache ich mir hier selbst gerade Stress? Das kommt wahrscheinlich ja aus meinem Inneren heraus, von meinem Anspruch. Sehen das die anderen überhaupt so oder sehe ich das nur selbst so? Sind das nur Gefühle?« Gefühle sind keine Fakten. Und selbst wenn ein anderer das auch sieht, ist das auch okay. Dann waren das jetzt gerade vielleicht nicht 100 Prozent bzw. es hat einfach nicht den Anforderungen der anderen Person entsprochen. Und auch die dürfen subjektiv sein.
Das heißt, wenn etwas für mich perfekt ist, kann es sein, dass es für die anderen nicht so ist und umgekehrt. Also da wirklich den Druck herauszunehmen, einen Schritt zurückzugehen und in größerer Perspektive zu schauen, was das hier bedeutet und vielleicht den sog. »Vier-Wochen-Test« zu machen: Wenn in vier Wochen noch immer darüber gesprochen wird, dann kann man sich das vielleicht anschauen und darüber reden, was wir hier besser machen könnten. Aber wenn das nur im Moment ein Gefühl ist, dann darf das auch einfach da sein und ist morgen vielleicht schon wieder gut.

Charlotte: Das ist eine sehr schöne Geschichte mit dem kleinen Rückschlag, der für dich dann aber doch so ein Wegweiser in Richtung Zukunft war, dass du dann doch hinterher etwas mit Sprachen studiert hast. Hätte natürlich auch sein können, dass ein anderes Schulkind, was da die Drei oder Vier bekommt, einfach die Stärken woanders hat als in Sprachen. Das ist bei mir zum Beispiel in Bezug auf Vorträge so. Das ist so die typische unliebsame Aufgabe, wo einfach nicht meine Stärken liegen und wo ich mich sehr unsicher fühle, wenn ich Präsentationen oder Vorträge halten muss. Ist es dann besser, zu sagen: Okay, ich mache jetzt so ein bisschen Konfrontationstherapie und suche mir quasi jeden Vortrag, den ich halten kann, um das irgendwie zu üben und die Unsicherheit somit auf eine etwas rabiate Art und Weise zu bekämpfen? Oder ist es da eher besser, zu sagen: Ich akzeptiere, dass das nicht meine Stärke ist. Meine liegen nun einmal woanders und ich suche mir Tätigkeitsfelder oder Jobs, wo – wie in diesem Fall – eben Vorträge halten (oder wie auch immer die unliebsame Aufgabe aussehen mag), nicht viel Raum einnimmt?
Kerstin: Ich bin da total für den Mittelweg. Ich finde, weder das eine noch das andere ist eine Lösung. Also prinzipiell anzuerkennen, dass wir in gewissen Bereichen Stärken haben und in anderen Bereichen nicht, finde ich wahnsinnig wichtig. Auch da wird der Druck herausgenommen.
Also ich zum Beispiel stelle mich total doof an, wenn es um Zahlen geht. Ich kann nicht kopfrechnen und ich weiß, ich könnte das trainieren. Aber es gibt so viele Möglichkeiten zu rechnen, dass ich beschlossen habe, ich setze meine Energien für etwas anderes ein. Deswegen bin ich auch nicht für Konfrontationstherapie. Denn wenn jemand schon unsicher ist und ich diese Person dann noch dazu zwinge, dass sie sich jetzt in all dieser Unsicherheit auf eine Bühne vor 2.000 Menschen stellt und auf Knopfdruck jetzt bitte eine Rede halten soll – das kann funktionieren. Das kann aber auch so richtig schief gehen.
Denn wir kennen ja alle unsere Komfortzone. Wir kennen auch diese Redewendung, die Komfortzone immer wieder zu verlassen, ist kein Fehler, denn so lernen wir. So entwickeln wir uns weiter. Das Problem mit der Konfrontationstherapie ist, dass sie uns in die Panikzone bringt. Und in der Panikzone lernen wir nicht, sondern unser Körper schaltet wirklich in den Panikmodus. In diesem Panikmodus sind wir nicht mehr in der Lage, Informationen aufzunehmen. Da geht es gefühlt wirklich ums nackte Überleben. Also der Körper kann dann auch nicht mehr unterscheiden, ob jetzt wirklich so ein Raubtier vor uns steht und wir in Lebensgefahr sind, oder eben auf einer Bühne stehen und wahnsinnig Angst vor dieser Situation haben. Das ist für den Körper dasselbe. Und von daher ist es so wahnsinnig wichtig, dann aus der Panikzone zurück wieder in die Stretch-Zone zu kommen, wo wir dazulernen können. Also wir sind dann nicht ganz in der Komfortzone, wir lernen dazu, aber es ist noch so komfortabel in dem Sinne, dass wir keine Panik haben und dass wir uns wohlfühlen.
Als Menschen haben wir diese Gabe, lernen zu können. Das ist etwas wahnsinnig Schönes. Also wenn ich nicht in der Lage bin, kopfzurechnen, dann weiß ich, ich kann das lernen. Und Vorträge halten, auch da gibt es unterschiedlichste Strategien und Methoden, das zu verbessern und zu einem Punkt zu kommen, wo du sagst, okay, jetzt fühle ich mich wohl. Die Frage ist einfach, möchtest du das? Welchen Kontext kannst du dir vorstellen? Es ist ja auch so vielseitig. Da kommt es ja auch darauf an, ob du mit einer Person sprichst oder vor fünf Leuten oder vor 100 Leuten. Und ich zum Beispiel, ich liebe es, Vorträge zu halten. Ich liebe es, vor Menschen zu sprechen. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt ohne Weiteres bereit wäre, auf eine Bühne zu gehen, wo 500 Leute im Publikum sitzen. Da ist dann so meine Grenze, wo ich sage: »Also da hätte ich jetzt gern erst einmal ein Training bitte, wie das geht.«
Charlotte: Also geht es im Prinzip auch so ein bisschen um die Balance zwischen lernbereit bleiben, aber sich selbst nicht unter so massiven Druck zu setzen, dass man in diese Panikzone gerät?
Kerstin: Genau.
Charlotte: Das ist natürlich die Seite, die ich selbst in der Hand habe: Wie sehr ich mich selbst unter Druck setze. Druck kann aber auch unter Umständen von außen kommen, je nachdem, in welcher Arbeitsumgebung ich mich befinde. Und es gibt leider auch Unternehmen, die das Gefühl, niemals wirklich so richtig ausreichend zu performen, mit ihrem Führungsstil regelrecht kultivieren, weil sie meinen, nur dadurch kämen Höchstleistungen zustande. Woran erkenne ich, dass meine eigene Unsicherheit so gar nicht das eigentliche Problem, sondern mein Arbeitsumfeld toxisch ist? Wann ist es ratsam, da die Reißleine zu ziehen und das Umfeld zu wechseln?
Kerstin: Das ist tatsächlich in manchen Unternehmenskulturen eine Strategie, Menschen zu Höchstleistungen zu motivieren – oder zumindest ein Versuch dazu. Was ich hier sehr wichtig finde ist, das nicht zu verteufeln in dem Sinne, weil es Menschen gibt, die das tatsächlich auch gerne machen. Ich vergleiche es gerne mit Sport. Leistungssportler mögen diesen Ansporn und wollen quasi immer noch weiter, noch schneller, noch bessere Ziele erreichen. Ich bin so gar keine Leistungssportlerin. Ich mag es eher gemütlich und ich mache Sport, wenn ich ihn mache, dafür, dass ich mich gut fühle. Und bin immer recht unbeeindruckt davon, wenn jemand, z.B. beim Bouldern, sagt, hier und da könnte ich mich doch noch ein bisschen herausfordern und die nächste Schwierigkeitsstufe erreichen. Habe ich keine Lust drauf. Es gibt einfach verschiedene Typen von Menschen. Und es gibt einfach Menschen, die sich ständig herausfordern wollen und auch angefeuert werden wollen, um zum Beispiel das nächste Verkaufsziel zu erreichen. Im dem Falle ist das eine super Umgebung für diese Menschen. Aber wenn man selbst merkt, dass man sich in einem solchen Umfeld nicht wohl fühlt und diesen Ansporn nicht braucht, dann sollte man irgendwann die Reißleine zu ziehen. Ich finde, lieber früher als später, wenn man das Gefühl hat, sich irgendwie fehl am Platz zu fühlen. Oder den Eindruck bekommt, sich in einer Unternehmenskultur zu befinden, mit der man nichts anfangen kann. Denn Kultur wird sich nicht so schnell verändern. Und wenn man selbst das Gefühl hat, man müsse sich selbst verändern, um hineinzupassen – dann wissen wir alle, dass das nicht gesund ist und sich natürlich dann in weiterer Folge auch auf das Selbstwertgefühl negativ auswirkt. Von daher lieber früher als später und auch im Bewusstsein dafür, dass es andere Umgebungen gibt. Es ist nicht so, dass dies in allen Firmen ein Teil der Unternehmenskultur ist.
Charlotte: Selbst in Umgebungen, die prinzipiell gut und passend für mich sind, kann es ja trotzdem einmal vorkommen, dass ich mit Situationen konfrontiert werde, auf die ich so gar nicht vorbereitet bin und die in mir totale Unsicherheit auslösen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand bei dir zur Tür herein käme und sagen würde, »Kerstin, ich habe dich jetzt für eine Kopfrechen-Challenge angemeldet. Die beginnt in fünf Minuten.«, oder mein Chef käme durch die Tür und würde sagen, »So, du musst mich jetzt bei einem Vortrag vertreten, jetzt sofort.« Wie gehe ich in solchen Akutsituationen, wo ich mich nicht darauf vorbereiten kann, in denen ich nicht nachdenken, reflektieren kann, wie kann ich da irgendwie mit umgehen? Ich komme also in die Panikzone: Was mache ich da?
Kerstin: In der Panikzone immer erst einmal durchatmen. Es ist tatsächlich eine Strategie, die sehr unterschätzt wird und wo ich mich selbst immer wieder daran erinnern darf. Die Atmung macht so wahnsinnig viel mit unserem Körper. Und wenn wir uns in einer Stresssituation befinden, dann kann es sehr hilfreich sein, erst einmal wirklich auch den Körper mitzunehmen. Also nicht versuchen, alles mit dem Kopf zu lösen und sich irgendetwas einzureden, sondern wirklich den Körper mitzunehmen, sich auch so zu positionieren, wieder eine sichere Haltung einzunehmen. Oft sieht man das ja schon, wenn die Schultern zusammenfallen und man sich irgendwie anspannt. Stattdessen den Körper aufrichten, einmal durchatmen und sagen, »Es ist erst einmal alles okay.« Und dann, wenn ich mich schon ein bisschen besser fühle, wieder den Blick noch einmal aus der Vogelperspektive darauf richten und nicht auf das Problem und auf die Panik gerichtet, sondern auf die Situation: »Was wird denn gerade von mir verlangt?« Und wir haben immer die Option, »nein« zu sagen. Das finde ich so wichtig, sich das zu verdeutlichen. Wir haben immer die Option, »nein« zu sagen. Also was wäre denn, wenn du im nächsten Moment bewusstlos zusammenklappst? Dann kannst du auch niemanden für einen Vortrag vertreten. Was wäre denn, wenn du ohnehin zu Hause krank liegen würdest? Dann wärst du auch nicht verfügbar für diese Vertretung. Sich von diesem Druck frei zu machen und zu sagen, es ist hier meine freie Wahl und meine freie Entscheidung. Und wir sind alle mündige, erwachsene Bürgerinnen und Bürger. Und wenn mich jemand zu einer Kopfrechen-Challenge herausfordert, dann kann ich dir ziemlich sicher sagen, dass ich »nein« sagen werde. Oder ich lasse mich auf ein Spiel ein, weil ich weiß, es passiert nichts, wenn ich die falschen Antworten gebe. Also ein wenig Leichtigkeit hineinbringen.
Im Falle des Vortrags könnte man natürlich auch sagen, »Ich will das jetzt ausprobieren«. Schau dir mal an, was denn dein aktuelles Bild von dem Vortrag ist, was deine Vorstellung einer »guten Performance« ist. Und was wäre denn ein alternatives Bild, wo du z.B. dem Publikum eine Frage stellst – dann richtest du die Aufmerksamkeit erst einmal weg von dir. Dann ist erst einmal jeder beschäftigt mit sich selbst und versucht, irgendwie eine Antwort auf diese Frage zu finden. Du kannst wunderbar Menschen inspirieren, indem du Fragen an sie richtest. Das heißt, vielleicht findest du ja auch für dich ein Format, das du dir für einen Vortrag oder für einen Workshop dann plötzlich gut vorstellen kannst, wo die Angst sich plötzlich in Luft auflöst.

Charlotte: Im schlimmsten Falle ist Ohnmacht simulieren vielleicht auch ein Ausweg ;)
Aber ein Denkfehler, den wir in Bezug auf Unsicherheit oft machen ist, dass wir davon ausgehen, dass die anderen alle viel souveräner sind und nur ich die Einzige bin, die da irgendwie unsicher ist. Dabei ist es ja ein Gefühl, was eigentlich fast jeder und jede regelmäßig erlebt. Wie kann ich denn trotz dieses Tabuthemas mit anderen Menschen und ganz speziell auch mit Arbeitskolleg*innen darüber in einen authentischen Austausch kommen, obwohl das Thema fast schon stigmatisiert ist und auch immer mit der Angst vor einem Gesichtsverlust verbunden ist?
Kerstin: Was mir oft wahnsinnig hilft, ist die Erinnerung daran, dass wir alle tatsächlich im selben Boot sitzen. Menschen, die behaupten, sie wären nie und in keiner Situation unsicher – also ich möchte da niemandem zu nahe treten – aber ich kann das mir nicht vorstellen. Ich glaube es nicht. Vielleicht geht es auch darum, wirklich zuzugeben und den Mut zu haben, sich verletzlich zu zeigen. Und das ist natürlich nicht einfach. Ich finde es immer wieder schön, dass es belohnt wird, in bestimmten Situationen und in bestimmten Verbindungen. Erst, wenn wir uns verletzlich zeigen, zeigen wir uns wirklich als die Menschen, die wir sind und nicht mehr mit einer Maske. Je mehr Verletzlichkeit ich in bestimmten Situationen zeige, desto mehr merke ich auch, dass sich auch meine Umgebung verändert und sich dann auch traut, sich mal verletzlich zu zeigen. Das ist ein schöner Effekt.
Des Weiteren kann eine klare Strategie hilfreich sein, die wieder mit Sprache zu tun hat: Die Formulierung ins Positive zu wenden. Und da wären wir wieder so ein bisschen beim Anfang bzw. hier schließt sich, wie ich finde, wieder der Kreis. Es macht ja einen Unterschied, ob ich sage, »Oh mein Gott, ich bin gerade so nervös. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Oh Gott, jetzt fängt irgendwie hier gleich mein Vortrag an!« – oder ob ich sage, »Ja, ich bin ganz aufgeregt gerade.« Sich wirklich positive Formulierungen für Situationen überlegen, die uns herausfordern, und diese Formulierungen dann auch aussprechen und die gegenüber Kolleginnen und Kollegen kommunizieren – und zwar nicht in einer Form, die Mitleid auslöst oder die einen selbst in so eine Opferrolle bringt, sondern tatsächlich anspricht, »Leute, ich bin gerade richtig aufgeregt, weil es ist dann jetzt das erste Mal, dass ich das und das mache.« Und beobachten, was dann passiert. Dann ist man nicht mehr alleine mit der Unsicherheit und wird dann in den allermeisten Fällen auch unterstützt.
Charlotte: Ja, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Aspekt, dass die meisten Menschen einen unterstützen wollen und einem nur in den seltensten Fällen etwas Böses wollen. Hinzu kommt, dass man somit selbst als Multiplikator oder Multiplikatorin fungieren kann, in dem man sich verletzlich zeigt und Gefühle offen anspricht und damit auch anderen den Raum eröffnet, das Gleiche zu tun, und somit auch zu einer guten Unternehmenskultur beitragen kann. Das ist ein Aspekt, der mich persönlich sehr motiviert.
Kerstin: Das stimmt.
Charlotte: Kerstin, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle und inspirierende Gespräch. Und falls du, liebe Hörerin, lieber Hörer, Kerstin noch besser kennenlernen möchtest beziehungsweise dich gerne von ihr coachen lassen möchtest, zum Beispiel, weil du dir Orientierung bei der Jobsuche wünschst oder Unterstützung bei wichtigen Zukunftsentscheidungen oder einfach einmal ein umfassendes Bild deiner Stärken, deiner Werte und deiner persönlichen Mission erhalten willst, besuche gerne die Webseite von skill tree.